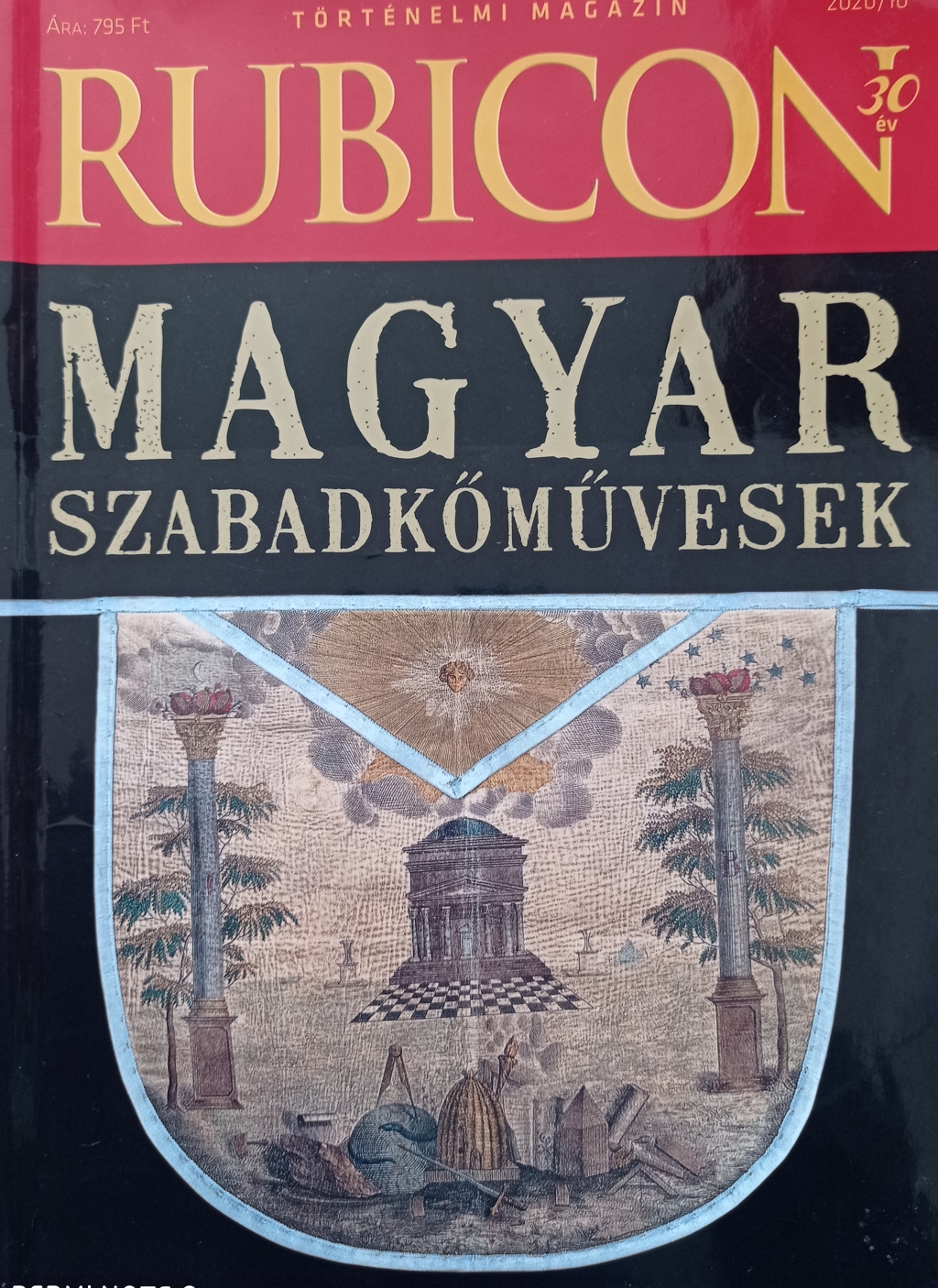Einige Intellektuellen Deutschlands fühlten sich das zweite Mal dazu veranlasst, ihr Bedenken und Befürchtungen zum Ukrainekrieg mit dem Appell „Waffenstillstand jetzt!“ öffentlich kundzutun. Als Intellektuelle, die sich seit dem s.g. Dreyfuss-Prozess als Beschützer der Wahrheit verstehen, müssen sie es sogar. Ihr Anspruch, sich in die öffentlichen Angelegenheiten einzumischen führt dazu, dass sie in komplizierten und schwierigen politischen Situationen laut und unbequem werden und hartnäckig, dennoch richtigerweise auf universelle Werte pochen. Was sie jedoch nicht machen dürfen, als Expert*innen auftreten, wenn sie keine sind.
Es fällt eines bezüglich der beiden offenen Briefe in Emma Ende April und in der Zeit Ende Juni auf: Unter den Unterzeichner*innen befinden sich keine Osteuropa-Expert*innen. Sie haben weder zu dieser Region geforscht, noch sprechen sie höchstwahrscheinlich die Sprachen. Sie sind größtenteils Philosoph*innen und Künstler, selbst die Politikwissenschaftler unter ihrer Reihe haben ihren Forschungsschwerpunkt nicht auf Osteuropa liegen. Wenn in den politischen Talkshows über den Ukrainekrieg diskutiert wird, sind die Wissenschaftler*innen der zwei Briefe gern gesehene Gäste. Das erweckt den Anschein, wie darauf Franziska Davies schon hingewiesen hat, dass sie wegen ihrer Osteuropa-Expertise eingeladen worden sind, und nicht, wie das tatsächlich der Fall ist, wegen ihrer markanten Meinung. Dass gerade Journalist*innen offensichtlich nicht zwischen Expertise und Meinung unterscheiden können oder wollen, ist ein schwerwiegendes Problem, denn sie nehmen Einfluss auf die öffentliche Meinung und sie suggerieren die Gleichsetzung von jahrelanger Forschung und ideologiegeleiteten Überzeugungen. Für die Einordnung der unterschiedlichen Positionen in der Öffentlichkeit braucht es allerdings Regionalexpertise jenseits der universalistischen Forderungen nach Waffenstillstand, Verhandlungen und Frieden.
Gerade die aus einer universalistischer Perspektive geführte Argumentation auf der Metaebene lockt die Diskussion auf eine falsche Fährte. Eine solche Diskussion mithilfe von universal und konstant verstanden Werten und Konzepten wie Frieden, Freiheit, Demokratie oder Nation mag ein intellektueller Denkakt sein, ist jedoch naiv und realitätsfern. Diese Ideen existieren nämlich immer nur in ihren spezifischen kulturellen und gesellschaftlichen Zusammenhängen und spiegeln sich auch in den unterschiedlichen politischen Logiken, Diskursen und Praktiken wider. Wer entlang allgemeingültiger Kategorien und Konzepte argumentiert, ohne zu wissen, wie diese in den betroffenen Ländern konstruiert und ausgehandelt werden, ignoriert die Wirklichkeit, die keineswegs universalistisch ist.
Die Wörter „Eskalations-“ und „Steigerungsdynamik“, deren sich die Unterzeichner*innen als Totschlagargument bedienen, verschweigen die Tatsache, das der Ukrainekrieg nicht nach dem Schmetterlingseffekt funktioniert. In diesem Fall kann der treibende Akteur eindeutig benannt werden, er heißt Vladimir Putin. Noch verblüffender ist die normative Vorstellung vom Krieg im zweiten offenen Brief. Danach ist es ein Grundsatz, der keiner weiteren Erklärung bedarf, dass „in festgefahrenen Konflikten“ „Kriegsparteien Maximalforderungen stellen oder Friedensgespräche ausdrücklich ablehnen.“ Dies ist jedoch kein Grundsatz, sondern eine billige Binsenweisheit, die in diesem Fall sogar schlichtweg falsch ist. Sie ignoriert die Tatsache, dass es nicht um zwei Kriegsparteien geht, sondern um einen brutalen Aggressor, der nicht einmal das Kriegsrecht beachtet, und um ein überfallenes Land, das den imperialistischen Träumereien des russischen Machthabers zum Opfer gefallen ist und sich jetzt mit allen Kräften und Möglichkeit dagegen wehrt. Die Aussage ist auch deswegen nicht haltbar, da Volodymyr Zelens’kyj, im Unterschied zu Putin, sich durchaus verhandlungsbereit und kompromissbereit zeigte. Putin hingegen erkennt Zelens’kyj als Handlungspartner nicht einmal an, und seine Maximalforderung ist mit nichts zu rechtfertigen: Sie zielt auf die physische und symbolische Auslöschung der Ukraine ab. Wie kann man eine ehrliche Diplomatie mit Putins Russland unter diesen Bedingungen für möglich halten? Wer also in dieser konkreten Situation, die in einen bestimmten sozio-kulturellen und geschichtlichen Kontext eingebettet ist, argumentiert, dass Waffenlieferungen nie ethisch richtig sein können, wer einfach aus ihrem Sessel heraus den erbitterten Verteidigungskampf der Ukrainer und Ukrainerinnen nicht mehr sehen will und einen sofortigen Waffenstillstand fordert, ist fernab jeglicher Realität. Eine solche Person gibt nicht nur ihre regionale Unkenntnis preis, sondern ignoriert schlichtweg das Völkerrecht. Die Selbstverteidigung gegen einen bewaffneten Angriff ist ein legitimes Recht, das der Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen festlegt. Sie kann auch kollektiv ausgeübt werden, und damit bewegt sich jegliche Art der Hilfeleistung anderer Staaten auf dem Boden des Völkerrechts. Es gibt nur einen, nämlich Russland, der diesen Boden spätestens 2014 verlassen hat. Die Intellektuellen, die sofortigen Waffenstillstand fordern, ignorieren auch die Erkenntnisse der Friedensforschung, die bewiesen hat: Die Abwesenheit von militärischer Gewalt bedeutet noch lange keinen positiven Frieden. Der Waffenstillstand geht nicht automatisch mit dem sofortigen Stopp jeglicher Form von Gewalt einher, solche Regionen bleiben ohne genügende politische Anstrengungen weiterhin instabil. Aber die Unterzeichner*innen scheinen am nachhaltigen positiven Frieden nicht ernsthaft interessiert zu sein, sie wollen lediglich durch das Schießen und menschliche Sterben nicht gestört werden, alles andere, wie die Menschen selbst jenseits der Karpaten leben wollen oder müssen, ist egal. Sie verstecken sich hinter Euphemismen wie „Kriegsparteien“ und „festgefahrenen Konflikten“ und beschwören auf Banalitäten herauf, wie „Einen Diktatfrieden Putins darf es nicht geben“, die mit seriösen Lösungsansätzen nichts zu tun haben.
Das intellektuelle Armutszeugnis wird durch den überheblichen, kolonialen Blick auf Osteuropa abgerundet. Über den Ukrainekrieg zu sprechen, ohne die kulturellen, sprachlichen, gesellschaftlichen, geschichtlichen und politischen Gegebenheiten der osteuropäischen Länder mitzubedenken, und ohne sie als Akteure wahrzunehmen, offenbart ein okzidentalistisches Weltbild, das nicht frei von der Idee des Kulturgefälles ist. Die Politikwissenschaftlerin Ulrike Guérot bezeichnet den Ukrainekrieg als einen Proxykrieg und glaubt den Schlüssel für die Beendung des Konflikts in den USA gefunden zu haben, erwähnt jedoch die Ukraine als Handelnde mit keinem Wort. Harald Welzer leitet seine moralische Überlegenheitsposition wiederum aus der deutschen Vergangenheitsbewältigung und den Kriegserfahrungen in seiner eigenen Familie ab und klammert dabei die geschichtlichen sowie gegenwärtigen Kriegserfahrungen der Ukrainer*innen aus. Und die Philosophin Svenja Flaßpöhler erhebt Anspruch darauf, zu entscheiden, „ab welchem Punkt die Opfer, die dieser Krieg fordert, nicht mehr zu rechtfertigen sind“ und bezeichnet die souveräne Entscheidung der ehemaligen Ostblockländer, der NATO beitreten zu wollen, als Ideologie. Diese Art von Kommunikation, die mit „Stellvertreterkrieg“, „NATO-Osterweiterung“ als „Provokation“ argumentiert, gehört zum „geopolitischen Fatalismus“, denn sie denkt in „quasi-naturgesetzlichen Einflusssphären“ von Großmächten und objektiviert die Länder Osteuropas. Damit richten die zitierten Intellektuellen als wichtige Meinungsträger enormen Schaden an, denn bedauerlicherweise korrespondiert ihre postkoloniale Erzählung mit Putins imperialistischem Narrativ.
Auf diesen verengten, kolonialen Blick wies die Direktorin des Zentrums für Osteuropa- und Internationale Studien, Gwendolyn Sasse, hin, als sie sich beklagte, wie häufig und in welchen Kontexten die osteuropäischen Länder in der Berichterstattung und in den Diskussionen – wenn überhaupt – vorkommen. Nach ihr ist Expertise über Osteuropa immer dann gefragt, „wenn es eine große Kriese gibt oder zu bestimmten Themen wie Krieg und Korruption. Das prägt das öffentliche Bild, insbesondere der Ukraine, aber viele Jahre haben wir andere Themen gar nicht platzieren können… Das sagt viel aus.“ Die Nichtbeachtung der östlichen Hälfte Europas und die Wiederholung von Klischees mögen in vermeintlichen Friedenszeiten in der breiten Öffentlichkeit belanglos erscheinen. In Krisensituationen wie jetzt ist das zu wenig. In dieser Stunde ist es geboten, Dinge bei ihren richtigen Namen zu nennen, Expert*innen mit Regionalwissen von Wissenschaftler*innen und Intellektuellen ohne dieses Wissen, Opfer von Tätern sowie Recht von Unrecht zu trennen wissen. Damit gültige und tiefgreifende Einschätzungen der Lage geliefert werden, sollten Ukraine- und Russland-Expert*innen vor einer größeren Öffentlichkeit zu Wort kommen können und wollen. In diesem Fall wäre die Öffentlichkeit, den politischen Würdenträger mit eingeschlossen, über den russischen Angriff nicht so fassungslos gewesen. Die Osteuropahistorikerin Anna Veronika Wendland warnte in Bezug auf den Krieg in der Ostukraine schon 2014 vor dem Fehler, „die Sprachpräferenz, die »ethnische« Zugehörigkeit und die politische Orientierung gleichzusetzen und die Mehrsprachigkeit oder situative Zweisprachigkeit der Menschen in der Ukraine zu ignorieren“, die in Deutschland „zu der platten Fehlwahrnehmung geführt [hat], dass es sich um einen ethnischen Konflikt handele.“ Franziska Davies hob wiederum nach dem Schlagabtausch zwischen Andrij Melnyk und Harald Welzer die geschichtliche Erfahrung vieler osteuropäischen Nationen mit dem bewaffneten Kampf als Partisan*innen oder Rotarmist*innen hervor, was ihre Kultur und geschichtliches Verständnis bis heute prägt. Um den enormen ukrainischen Widerstand verstehen und die politischen Handlungen und Argumente der osteuropäischen Länder nachvollziehen zu können, ist die Kenntnis von diesen Kriegserinnerungen unabdingbar. Solche Analysen sind allerdings die Ergebnisse langjähriger intensiver Forschung. Damit leistet die interdisziplinäre Osteuropakunde einen großartigen Beitrag zur Wissensproduktion, gerade, weil sie die Region ganzheitlich und unter verschiedenen Disziplinären untersucht.
Es zeugt nicht nur von Unwissen, aber auch von fehlendem Interesse, wenn Intellektuelle in der Debatte die Ukraine mit Ungarn verwechseln. Es wäre daher wünschenswert, ehrliches Interesse am Gegenstand der Diskussion mitzubringen und auch die Bereitschaft, die Perspektive zu wechseln und über Osteuropa und (was für eine Zumutung) gegebenenfalls von Osteuropa lernen zu wollen. Darüber hinaus wäre eine Wissenschaftspolitik in Deutschland förderlich, die den Wert der Regionalexpertise erkennt und darin investiert, anstatt Lehrstühle und Gelder für Stipendien zu streichen. Denn es ist immens wichtig, die Belastbarkeit der Argumente in den öffentlichen Diskursen einem osteuropäischen Wirklichkeitscheck der Regionalwissenschaftler*innen zu unterziehen. Das taten die Ukraineexpertinnen Susann Worschech, und Franziska Davies, indem sie eine schonungslose Kritik an den Autor*innen des Appells übten: „Die Protagonisten des Offenen Briefes ignorieren vorhandene Expertise, um sich selbst als ‘marginalisiert’ zu inszenieren, und sie betreiben ein Vertauschen von Expertise und Meinung. […] Niemand der Unterzeichnenden hat sich je intensiv mit Russland oder [der] Ukraine beschäftigt, und umgekehrt findet sich nicht eine Osteuropa-Expertin unter ihnen. Auf Tagungen zu Osteuropa sind die Unterzeichnenden nicht anzutreffen; weder suchen sie das Gespräch mit der Fachcommunity, noch rezipieren sie deren Forschung und verknüpfen sie mit eigenen Erkenntnissen. In der viele Disziplinen umfassen den Osteuropaforschung […] herrscht in der Wahrnehmung des Krieges nicht zufällig ein breiter Konsens, der Resultat zahlreicher Forschungsprojekte, Veranstaltungen und Publikationen ist. Jahrelang haben Osteuropaforscher:innen die Entwicklung Russlands zu einem vollständig autoritären Régime mit aggressiv-imperialistischer Außenpolitik analysiert, ebenso wie die komplexe, ambivalente Transformation in der Ukraine hin zu einer fragilen, aber selbstbestimmten Demokratie.“ Auch Manfred Sapper und Volker Weichsel, die Redakteure der Zeitschrift Osteuropa, beschreiben die Lage im Klartext, wonach Russland den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelens’kyj stürzen, die Ukraine als souveränen Staat zerstören sowie die Identität des ukrainischen Volkes vernichten will. Außerdem greife Russland die Grundlagen der europäischen Friedensordnung an, daher sei im eigenen Interesse der europäischen Staaten, „die Selbstverteidigung der Ukraine politisch, wirtschaftlich und militärisch durch Waffenlieferungen zu unterstützen.“ Das ist Osteuropa-Expertise. Alles andere, was nicht auf der erkenntnisgeleiteten und professionellen Beschäftigung mit Osteuropa basiert, heißt hingegen Meinung.